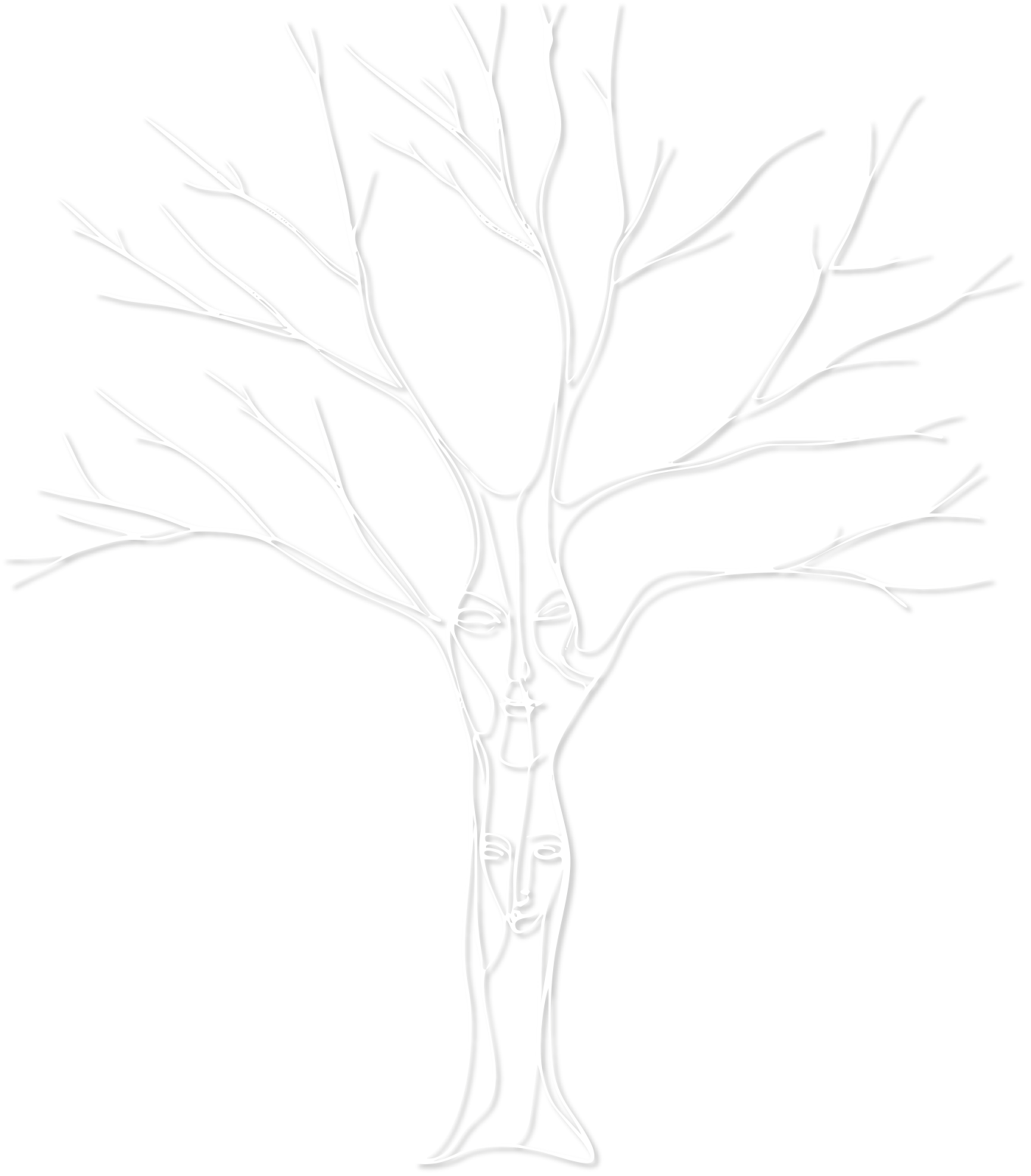Über Dramatherapie
Dramatherapie ist eine Form der Kunsttherapie, die Theater und darstellende Künste mit humanistischer Psychologie verbindet, um emotionale, psychische und soziale Herausforderungen zu bearbeiten.
Drama kommt aus dem altgriechischen und bedeutet Handlung. Eine Handlungs- und ressourcenorientierte Begleitung. Sie nutzt Schauspiel, Rollenspiel, Geschichten und kreative Methoden zur Selbsterforschung, Heilung und persönlichen Entwicklung.
Klienten können durch Rollenspiele, Improvisation und symbolische Darstellungen ihre Gedanken und Gefühle ausdrücken, ohne sich auf Worte allein verlassen zu müssen. Diese Methode kann besonders hilfreich sein für Menschen, die Schwierigkeiten haben, ihre Emotionen verbal zu kommunizieren. Durch die therapeutische Unterstützung können Klienten neue Perspektiven entwickeln, ihre Selbstwahrnehmung verbessern und kreative Lösungsansätze für persönliche Probleme finden. Auf eine spielerische Weise möchte ich in meiner Praxis die Heilung und der persönliche Wachstum fördern.
Durch kreativen Ausdruck – etwa Embodiment, Imagination, Arbeit mit Metaphern, Figuren oder Objekten – können schwierige Erlebnisse verarbeitet werden. Innere Zustände werden sichtbar und im Hier und Jetzt erfahrbar gemacht.
Dramatherapie baut eine Brücke zwischen Innen- und Außenwelt. Sie eröffnet neue Perspektiven, Handlungsmöglichkeiten und unterstützt dabei, Lösungen spielerisch zu entdecken – oft mit Hilfe des „Als-ob“ auf der Bühne, das Freiraum für Veränderung schafft.
Entdecken Sie die Kraft der Dramatherapie und gestalten Sie Ihr Leben neu!
Modelle der Dramatherapie
Dramatherapie ist eine Form der Kunsttherapie, die Theater und darstellende Künste mit humanistischer Psychologie verbindet, um emotionale, psychische und soziale Herausforderungen zu bearbeiten. Sie nutzt Schauspiel, Rollenspiel, Geschichten und kreative Methoden zur Selbsterforschung, Heilung und persönlichen Entwicklung.
Die Dramatherapie arbeitet nach drei verschiedenen Modelle:
Dramatische Realität
Der Begriff Drama stammt aus dem Altgriechischen und bedeutet „Handlung“. Im Zentrum der dramatischen Realität stehen daher das Handeln und Gestalten. Drama ist – wie Aristoteles (384–322 v. Chr.) es ausdrückte – „nicht die Nachahmung von Menschen, sondern von Handlungen und Lebensweisen“.
In der dramatischen Realität gestalten wir unsere Wirklichkeit aktiv mit. Bereits im Mutterleib erlebt das Kind das dramatische Zusammenspiel seiner Eltern – es wird als dramatisches Wesen geboren. Seit Anbeginn der Menschheit nutzt der Mensch diese Form der Realität, um sich selbst und die Welt zu begreifen.
Wie Susana Pendzik (2006) betont, betreten wir in der dramatischen Realität eine imaginäre Welt – ein „So-tun-als-ob“-Spiel. Diese Form des Spiels schafft eine imaginäre Insel, die dem Menschen Orientierung im Leben gibt. Das So-tun-als-ob ist zentral: Die Fähigkeit, sich etwas vorzustellen und es so zu erleben, als wäre es real, ist besonders in der Kindheit stark ausgeprägt. Ist diese Vorstellungskraft verloren gegangen, muss sie wiederbelebt werden – denn ohne Imagination verlieren wir eine essenzielle Verbindung zu uns selbst.
Ein zentrales Merkmal der dramatischen Realität ist ihre soziale Komponente: Um sie entstehen zu lassen, braucht es mindestens zwei Personen. Hierin liegt auch der Unterschied zur Fantasie: Fantasie ist privat und findet im Kopf statt. Dramatische Realität dagegen ist öffentlich, spürbar, erlebbar. Sie bietet einen geschützten Raum, in dem wir fürs Leben proben können.
EPR: Embodiment – Projektion – Rolle
In der kindlichen Entwicklung spielen die drei Stufen Embodiment, Projektion und Rolle eine zentrale Rolle. Werden diese Phasen nicht oder nur unzureichend durchlebt, kann dies langfristig die Entwicklung eines stabilen Selbst und einer gesunden Identität beeinträchtigen.
Embodiment
Im ersten Lebensjahr ist das Kind ganz mit sich und seinem Körper beschäftigt. Es erlebt sich durch sinnliches und körperliches Spiel, koordiniert seine Bewegungen und erkundet die Welt mit allen Sinnen: es greift, tastet, fühlt, beobachtet. In dieser Phase lernt das Kind seinen Körper kennen – ein Prozess, der als Embodiment bezeichnet wird.
Projektion
Gegen Ende des ersten Lebensjahres beginnt das Kind, seine Umwelt aktiver zu entdecken. Es lernt zu sprechen, zu gehen und beginnt, Gegenstände symbolisch aufzuladen: Ein Tannenzapfen wird zum Zwerg, ein Stock zum Flugzeug. Diese kreative Umdeutung ist die Phase der Projektion. Auch im bildnerischen Gestalten zeigt sich diese Fähigkeit – aus einem Gekritzel wird eine Geschichte. Typische Materialien in dieser Phase sind Ton, Farben, Puzzles und thematisch gestaltete Spielorte wie eine Bauecke oder ein Marronistand.
Rolle
Etwa ab dem dritten Lebensjahr beginnt das Kind, bewusst Rollen zu übernehmen – es spielt Vater, Mutter, Kranführer. In diesem Alter ist das Spiel noch stark ich-bezogen: Kinder spielen nebeneinander, aber nicht unbedingt miteinander. Erst im Vorschulalter entstehen erste gemeinsame Rollenspiele. Die Kinder beginnen, Szenen zu entwickeln, sich zu verkleiden und mehrere Rollen gleichzeitig zu spielen – etwas, das ihnen ganz selbstverständlich gelingt. Rituale helfen ihnen, Übergänge zu gestalten und geben Halt. Das kreative Improvisieren von Szenen, Märchen oder Geschichten macht ihnen große Freude.
Die ästhetische Distanz
Die ästhetische Distanz beschreibt die Fähigkeit, ein Gleichgewicht zwischen Gefühl, Verstand und Körper herzustellen. Sie ist wesentlich, um zwischen zwei Extremen zu vermitteln:
- Unterdistanzierung: Die Person wird von ihren Emotionen überwältigt. Eine Reflexion ist kaum möglich, da das emotionale Erleben überwiegt.
- Überdistanzierung: Emotionen werden stark zurückgehalten oder verdrängt. Die Person bleibt in einem kühlen, rein intellektuellen Modus und meidet die emotionale Auseinandersetzung.
Im Theater und in der dramatherapeutischen Arbeit ermöglicht die ästhetische Distanz eine Balance dieser Pole. Der Mensch ist gleichzeitig Beobachter und Teilnehmer. Er erlebt das Geschehen mit, bleibt dabei aber in einem sicheren Abstand.
Gerade in der Arbeit mit traumatisierten Menschen ist die ästhetische Distanz von zentraler Bedeutung. Sie erlaubt es, sich an belastende Erlebnisse zu erinnern, ohne von ihnen überrollt zu werden. Durch den Einsatz künstlerischer Mittel entsteht ein geschützter Raum, in dem Abstand gewonnen und das Erlebte verarbeitet werden kann
Wissenschaftliche Unterstützung
Dramatherapie wird durch Forschung in den Bereichen menschliche Entwicklung, Psychologie und Neurowissenschaften gestützt. Zum Beispiel wissen wir heute, dass Trauma im Körper gespeichert wird und dass verkörperte Ansätze wie die Dramatherapie notwendig sind, um Heilung zu ermöglichen. Wir wissen auch, dass Kreativität ein entscheidender Faktor für die neuronale Plastizität ist – also die Fähigkeit des Gehirns, seine Denk-, Reaktions- und Verarbeitungsweisen zu verändern.
« Im Herzen der Dramatherapie steht das kreative Spiel, das als universelle Sprache der Kommunikation und des Ausdrucks dient, durch die wir unsere tiefsten Ängste und höchsten Hoffnungen erkennen können. »
Sue Jennings